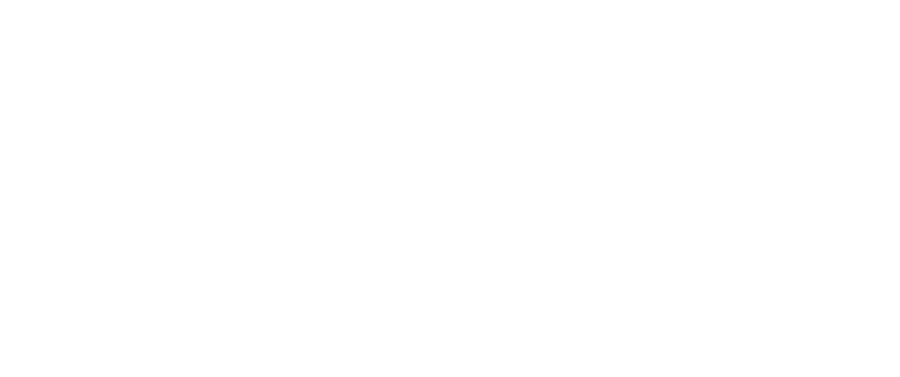Creatio – Hoffnung und Verantwortung
Serie: CREATIO | Bibeltext: Jesaja 43,19; Kolosser 1,15-19
Nachdem Gott die Welt geschaffen hatte, beurteilte Er sie als sehr gut. Dies vor allem auch deshalb, weil die Beziehungen innerhalb der einzelnen Gattungen und darüber hinaus perfekt aufeinander abgestimmt sind. Als der Mensch die einzige Einschränkung in seinem weiten Lebensraum missachtete, wurde die Welt verheerend aus dem Gleichgewicht geworfen. In Jesus Christus beginnt die Neuschöpfung mit dem Ziel, dass der Himmel auf die Erde kommt. Für Christen bedeutet dies gleichermassen Hoffnung und Verantwortung.
Wer Abstand gewinnt, sieht besser. So ging es dem deutschen Astronauten Alexander Gerst. In der Internationalen Raumstation gewann er in 400 km Höhe eine ganz neue Sicht auf unsere Erde. Überwältigt von ihrer Schönheit und ihrer offensichtlichen Zerbrechlichkeit wurde Gerst zum Aktivisten für einen nachhaltigen Umgang mit der Schöpfung.
Braucht Mensch diesen Perspektivenwechsel, um zu ahnen, wie Gott die Welt sieht? Riskieren wir es in diesem Jahr und versuchen, die Linse scharf zu stellen, um ein wenig mehr vom schöpferisch-göttlichen Durchblick zu gewinnen. Das Ziel ist nicht, dass wir zu ideologischen Umweltaktivisten werden, sondern zu Menschen, die ihren allerersten Auftrag an dieser Welt wahrnehmen.
Die gute Schöpfung
«Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde» (1Mose 1,1 NLB). Als erstes wird in der Bibel das kreative Schöpfungshandeln Gottes beschrieben. Faszinierend und detailreich füllt Gott einen Tag nach dem anderen mit werdenden Wundern. Fantasievoll und fantastisch entfaltet sich durch sein Wort die Schöpfung. Warum eigentlich erschafft er noch die siebzehnte Nachtfaltersorte? Nur ein Flügelfleck ist anders als bei der sechzehnten! Gott hatte Lust dazu. Solch kreative Variationen machen göttliche Fülle und seine Freude am Spiel anschaulich.
Und es war gut! Diese Zeile schallt wie ein Refrain durch das Schöpfungslied. Dieser Ausruf lässt uns an Gottes Gefühlen während der Schöpfung teilhaben. Das freudige Zufriedensein, wenn etwas richtig gut gelingt. Nach seinem letzten Werk tritt der Schöpfer zurück, gleich einer Chefköchin, die begeistert ihr Gourmet-Menü betrachtet – und es entfährt ihm ein: Und siehe, es ist SEHR gut!
An den ersten fünf Tagen sprach Gott sechsmal ein «Gut» aus. Am Ende des sechsten Tages wird das Wort zum siebenten Mal mit einem empathischen «Sehr» benutzt, um Gottes Schöpfung zu beschreiben. In der hebräischen Kultur symbolisiert die Zahl sieben Perfektion und Vollständigkeit. Mit diesem «Sehr gut» kommuniziert der Schreiber die Vollkommenheit sowie die perfekte Vernetzung der Schöpfung. Es ist «sehr gut», weil jede einzelne Kreatur einzigartig in Funktion und Ästhetik ist und weil die Beziehungen innerhalb der einzelnen Gattungen und darüber hinaus perfekt aufeinander abgestimmt sind. Die Beziehungen zwischen den geschaffenen Werken überfliessen von Wohlergehen und Reichtum.
Das ist ein wesentlicher Punkt im hebräischen Denken: Nicht nur das einzelne Objekt ist sehr gut, sondern die feine Vernetzung, das liebevolle Zusammenspiel zwischen Gott und Mensch, zwischen den Geschlechtern, zwischen den Nationen und zwischen Menschen und Schöpfung.
Eine schlechte Entscheidung
Was aber ist der erste Auftrag? «Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde» (1Mose 1,28 NLB). In Besitz nehmen und herrschen – nimmt man dies als Auftrag zur dominanten Herrschaft, führt in der Praxis ein kurzer Weg zum Ausbeuten der geschaffenen Welt. Und das mit göttlicher Legitimation! Viele sehen hier die ideengeschichtliche Wurzel der ökologischen Krise. Die Welt ist heute bedrohlich zerstört und fiebrig überhitzt, weil der Mensch sie ausbeutet. Und das ohne schlechtes Gewissen. Der Schöpfer hat es ja so gewollt.
Im zweiten Schöpfungsbericht steht: «Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er sollte ihn bebauen und bewahren» (1Mose 2,15 NLB). Es geht um hingebungsvolles Pflegen und bewahrendes Gestalten der guten Schöpfung Gottes. Eine gute Verwaltung dient und beschützt den Rest der Schöpfung. Der Mensch wurde als Ebenbild Gottes geschaffen und als solches gilt es auch Seinen Führungsstil, den eines guten Hirten, abzuschauen.
Kürzlich zeigte die Tagesschau einen aufrüttelnden Bericht über Kleiderberge in Accra, der Hauptstadt von Ghana. Wir Europäer kaufen massenweise neue Billigkleider, die nicht selten durch Kinderarbeit erstellt wurden. Wenn wir sie ausmisten, geben wir sie in die Altkleidersammlung. Dann gibt es Leute, die damit Geld verdienen, diese Kleider tonnenweise nach Afrika zu verschiffen. Ein Grossteil davon landet auf dem Müllberg, der eine grosse ökologische Krise verursacht. Die Kühe von Accra weiden auf diesen Müllbergen.
Wo ist das «sehr gut» geblieben? Ausbeutung von Menschen und Land, Frauenfeindlichkeit, Verarmung, Umweltzerstörung, Demütigung, Artensterben, etc. sind auf allen Newssendern präsent.
Warum ist das so? Gott setzte den Menschen in den riesigen Garten Eden. Eden ist vielleicht so gross wie die Schweiz. Ein Garten voller Entfaltungsmöglichkeiten. Gott gab den Menschen ein einziges Gebot: «Er befahl dem Menschen jedoch: ‘Du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben’» (1Mose 2,16f NLB). Beim Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen wurde der Mensch mit der Frage konfrontiert: Liebst du Gott? Vertrauen und Wahl gehören zu den fundamentalsten Voraussetzungen einer erwachsenen Liebesbeziehung. Um es kurz zu machen: Der Mensch misstraute Gott und traf eine verhängnisvolle Wahl mit weitreichenden und verheerenden Folgen. Die zerbrochene Gemeinschaft zwischen den Menschen und Gott ist der massgebende Grund für alle anderen Brüche in der Schöpfung. Mit anderen Worten: Es ist unmöglich, dass die Menschheit die Beziehung zu einem anderen geschaffenen Wesen verletzt, ohne ihre Beziehung zu Gott zu verletzen. Wenn eine Beziehung gebrochen wird, werden die anderen ebenfalls zerstört.
Diesen Zusammenhang sehen wir auch bei den Propheten: «Hört das Wort des Herrn, ihr Israeliten! Der Herr führt einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes. Er wirft euch vor: In eurem Land gibt es keine Treue, keine Mitmenschlichkeit und auch keine Gotteserkenntnis. Ihr flucht und lügt, mordet, stehlt und brecht die Ehe. Eine Bluttat reiht sich an die andere. Das ist die Ursache dafür, dass in eurem Land nichts mehr wächst. Das ganze Land trauert, und alles, was darin lebt, wird krank. Selbst die Tiere, Vögel und Fische verenden» (Hosea 4,1-3 NLB).
Das Land wird zum Barometer des geistlichen Zustandes seiner Bewohner. Es wird deutlich: Gott hat den Menschen als Teil eines fein gewobenen Netzes erschaffen. Er lebt und webt sein Sein in Abhängigkeit von Gott, Mitmenschen und Umwelt. Wo der Mensch dieses Netz zerschneidet, degeneriert alles.
Die geniale Neuschöpfung
«Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr’s denn nicht?» (Jesaja 43,19 LUT). Die ganze Bibel von dem Zwischenfall in Eden bis zur Offenbarung spricht von Gottes Plan, wie er die Welt erlösen und den ursprünglichen Frieden wiederherstellen wird. Dreh- und Angelpunkt dabei ist Jesus Christus. In ihm zeigt Gott, wie er seine liebevolle erdachte Schöpfung und den ganzen Kosmos (vgl. Johannes 3,16) zu erlösen gedenkt.
Auch Jesus wurde ein Opfer von menschlicher Gewalt und eigennütziger Machtpolitik. Als er mit 33 Jahren am Kreuz stirbt, geschieht etwas Fulminantes: Das Innere der Erde wird von einem gewaltigen Beben erschüttert. Die geschaffene Welt spürt im Kern, dass auf Golgatha ihre Neuschöpfung beginnt. Sein Auferstehungsleib ist eine erste Kostprobe der Neuschöpfung. Die Neuschöpfung ist nicht nur geistlich und jenseitig, sondern materiell und diesseitig.
So beschreibt es auch Paulus: «Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, […] Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. […] Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen […] durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, […] indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz» (Kolosser 1,15-19 LUT).
Durch Jesus soll alles zu Gott hin versöhnt werden. Nicht selten belächeln gerade Evangelikale ein Engagement für die ganze Schöpfung. Keinesfalls will man in die Ecke einer Aktivistin wie Greta Thunberg gesteckt werden. Ihr Evangelium lässt sich mit wenigen Pinselstrichen darstellen: Gott liebt uns, doch wir sind sündig. Als Folge davon sind wir von Gott getrennt. Jesus starb, um die Strafe für unsere Sünden zu bezahlen. Alles, was wir tun müssen, ist zu glauben, dass der Tod von Jesus genügt und wir in den Himmel kommen.
Ein solches Evangelium greift viel zu kurz und widerspiegelt nur einen Bruchteil der guten Botschaft. Dieses Denken wird zum Nährboden einer ungesunden Durchreise-Spiritualität. Man erwartet keine Neuschöpfung mehr, sondern fokussiert sich auf die Entrückung als erlösende Befreiung von allem Leiblich-Irdischen. Wer so glaubt, dem ist die Schöpfung egal. «Lasst doch. Je schneller die Erde vergeht, desto besser!» Wenn Gott das Universum sowieso zerstören will, was sollen wir uns noch um den CO2-Fussabdruck kümmern.
Jesus hat ein wesentlich «dickeres» Evangelium gebracht. Sein Tod und die Auferstehung bewirken viel Grösseres. Die ganze Schöpfung seufzt und sehnt sich nach Erlösung (Römer 8,22). Die Auferstehungskraft vermag nicht nur Menschen mit Gott zu versöhnen, sondern auch die Beziehungsgeflechte der gesamten Schöpfung wiederherzustellen – und zwar hin zum Prädikat sehr gut.
Christliche Zukunftshoffnung ist keine geistige Verjenseitigung. Ganz im Gegenteil: Christen hoffen und beten, dass Gottes Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Wir erwarten, dass Gott sein Reich hier auf Erden entfalten wird. Genau wie Jesus in seinem neuen Körper gleichermassen himmlisch erneuert und sichtbar von Narben gekennzeichnet war, so ist auch die Neuschöpfung der Welt zu denken: Erneuert unter Einbezug alles bisher Gewordenen. Unsere Erde mit all ihrer materiellen Substanz ist das Rohmaterial für Gottes ewiges Königreich. Die von ihrer Vergänglichkeit (Römer 8) befreite Schöpfung findet den ewigen Ort ihres versöhnten Seins nicht im Himmel, sondern auf der Erde! Gott schenkt uns in Offenbarung 21 einen beeindruckenden Blick auf seine neue Schöpfung: Das neue Jerusalem schwebt herab auf die Erde! Die Neuschöpfung ereignet sich als kosmische Hochzeit, bei der der Himmel seinen Platz auf der Erde findet.
Creatio – Hoffnung und Verantwortung, so lautet unser Jahresthema. Menschen, die mit Christus verbunden sind und ihr Leben nach seinen Massstäben leben, hoffen voller Zuversicht auf die eigene Neuschöpfung sowie der der ganzen Erde. Zudem übernehmen sie die Verantwortung, dem Himmelreich auf dieser Welt ein Gesicht zu geben. Die Menschheit bekam die Aufgabe, der Schöpfung zu dienen und sie zu beschützen. Wenn Christen ihrer Rolle als neue Menschheit in Christus gerecht werden wollen, dann muss die Fürsorge für andere Menschen und die Umwelt ganz oben auf ihrer Prioritätenliste stehen.
Fragen für die Kleingruppen
Bibeltext lesen: Kolosser 1,15-19; Hosea 4,1-3
- Auf was bezieht sich das vom Schöpfer freudig ausgerufene «sehr gut» am sechsten Tag nach hebräischem Denken (1Mose 1,31)?
- Gott stellte den Menschen vor die Frage, ob er ihn liebt, indem er ihm verbot, von der einen Frucht zu essen. Versuche diesen Zusammenhang zu beschreiben!
- Was sagt der Auferstehungsleib von Jesus über die Neuschöpfung aus?
- Wie würdest du das Evangelium (gute Nachricht) der Bibel in wenigen Sätzen beschreiben?
- Creatio – Hoffnung und Verantwortung: Was ist die Hoffnung der Christen? Was ist ihre Verantwortung?