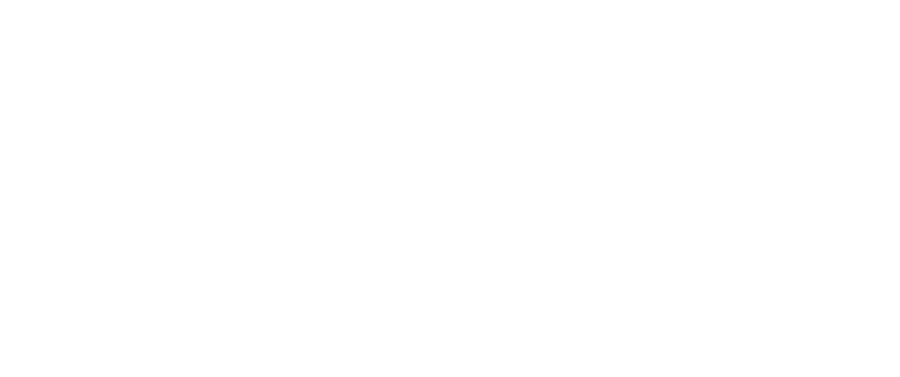Von der Vergebung zur Versöhnung
Serie: Folge du mir nach | Bibeltext: Matthäus 5,23f; 18,15-17
Die dritte Dimension der christlichen Vergebung ist die Versöhnung mit der Person, mit der wir in einem Konflikt stehen. Das eigentliche Ziel der Vergebung ist der Wiederaufbau einer vertrauensvollen Beziehung. Dies geschieht, in dem wir unseren eigenen Anteil am Konflikt klar benennen und bereuen. Anschliessend bieten wir der anderen Person Vergebung an und erklären den Verzicht auf Wiedergutmachung. Darüber hinaus fordert Jesus, dass wir das Böse mit Gutem überwinden sollen.
Es gibt drei grundlegende Dimensionen der christlichen Vergebung. Erstens gibt es die vertikale Dimension – Gottes Vergebung uns gegenüber. Zweitens gibt es die innere – die Vergebung, die wir jedem gewähren, der uns Unrecht zugefügt hat. Drittens gibt es die horizontale – unsere Bereitschaft zur Versöhnung. Martin Luther-King: «Wir können niemals sagen: ‘Ich werde vergeben, aber ich will nichts mehr mit dir zu tun haben.’ Vergebung bedeutet Versöhnung und Wiederannäherung.»
Letzten Sonntag wurde im Livestream eine gute Frage gestellt: «Ich wurde als Kind sehr verletzt. Doch alle sind gestorben. Wie kann ich ihnen vergeben?» Es ist wichtig, dass wir hier Klarheit bekommen: Wir sollen der Person, die an uns schuldig wurde, immer vergeben! Diese innere Vergebung braucht keine Reaktion des anderen; weder Einsicht noch Reue, weder Wiedergutmachung noch die Sicherheit, dass sich das Unrecht nicht wiederholt. Es ist ein Versprechen: die Sache gegenüber dem oder der Betreffenden nicht immer wieder aufzuwärmen (abgesehen vom Angebot der Versöhnung), sie gegenüber anderen nicht anzusprechen und sie auch nicht vor sich selbst ständig wieder wachzurufen. Als Stephanus starb und betete: «Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an!» (Apostelgeschichte 7,60 NLB), war es klar, dass die Täter keine Reue zeigten, denn sie steinigten und töteten ihn, während er sprach. Dennoch vergab Stephanus ihnen.
Die Vergebung als innere Einstellung kann ohne Versöhnung geschehen, aber Versöhnung kann nicht geschehen, wenn die innere Vergebung nicht schon geschehen ist. Innere Vergebung verändert die Haltung des Herzens von dem Wunsch, den Täter Schmerz fühlen zu lassen, zu dem Wunsch nach seinem Wohl.
Wann ist eine Konfrontation oder Versöhnung notwendig?
«Nehmt euch also in Acht! Wenn dein Bruder Schuld auf sich geladen hat, dann weise ihn zurecht. Bereut er sein Handeln, dann vergib ihm!» (Lukas 17,3 HFA). Sollen wir also jedes Mal, wenn uns jemand unrecht tut, zurechtweisen? Auf der andern Seite heisst es: «[...] die Liebe deckt viele Sünden zu» (1Petrus 4,8 NLB). So wie nicht jeder Schnupfen medikamentös behandelt werden muss, sollten wir auch auf der Beziehungsebene nicht zu empfindlich sein. Es verkompliziert eine Beziehung ungemein, wenn wir jede Kleinigkeit, bei der wir ungerecht oder unsensibel behandelt worden sind, zum Thema machen. Edith Stein (1891-1942): «Schiffe stranden an Felsen, menschliche Beziehungen oft schon an Kieselsteinen.» Je stärker unsere Identität in Christus gegründet ist, desto weniger empfindlich und verletzbar werden wir sein. Die gleiche Liebe, die viele Sünden zudecken sollte, sollte aber auch bereit sein, den Menschen zu konfrontieren, dem meine Liebe gilt. Angst vor der Konfrontation ist keine Liebe, sondern egoistisches Verlangen, selbst geliebt zu werden. Unter zwei Bedingungen sollten wir andere zurechthelfen:
- Wenn die Sache ernst genug ist, um die Beziehung abzukühlen oder abzubrechen. Jesus betont, dass der Zweck einer solchen Zurechtweisung darin besteht, die andere Person zu gewinnen, d.h. die Beziehung zu retten (Matthäus 18,15).
- Wenn schuldhaftes Verhalten gegen uns Teil eines Verhaltensmusters ist, in dem die andere Person ernsthaft gefangen, das für sie und für andere schädlich ist.
Wie sollen wir es tun? «Liebe Freunde, wenn ein Mensch einer Sünde erlegen ist, dann solltet ihr, deren Leben vom Geist Gottes bestimmt ist, diesem Menschen liebevoll und in aller Demut helfen, wieder auf den rechten Weg zurückzufinden. Und pass auf, dass du nicht in dieselbe Gefahr gerätst» (Galater 6,1 NLB). Das ist absolut entscheidend. Wenn es uns um das Wachstum des anderen geht, werden wir liebevoll und behutsam sein. Vers 2 und 3 weisen darauf hin, dass wir eine Korrektur nur in aller Bescheidenheit vornehmen sollten. «Pass auf, dass Du nicht in dieselbe Gefahr gerätst!» Oft stören uns Dinge beim Nächsten, denen wir selbst gerne erliegen. Da heisst es, sich selbst in Acht zu nehmen.
Folgende Anzeichen sprechen dafür, dass Versöhnung notwendig ist: Wenn ich die Augen verdrehe und denke: «Du Idiot. Du kriegst es echt nicht auf die Reihe.» Ich höre, dass der andere ein Problem hat, und empfinde Genugtuung. Ich ärgere mich über fast alles, was der andere tut. Ich fühle mich in der Beziehung zunehmend unwohl. Ich beginne, den anderen zu meiden. Ich habe die Möglichkeit, negative Informationen über die betreffende Person weiterzugeben, und geniesse es. Wir sprechen kaum miteinander. Die Spannung ist so offensichtlich, dass es anderen nicht verborgen bleibt.
Wie versöhnen wir uns?
Eines muss uns klar sein: Versöhnung braucht Zeit. Manche Menschen glauben, sie hätten sich erst dann versöhnt, wenn sie der anderen Person wieder vollständig vertrauen können. So ist es aber nicht. Horizontale Vergebung bedeutet die Bereitschaft, alles zu tun, um das Vertrauen wiederherzustellen. Wie schnell und in welchem Ausmass die Beziehung wiederaufgebaut werden kann, hängt auch davon ab, was und wie gravierend das Vergehen war. Jemandem nicht mehr so zu vertrauen wie früher, bedeutet nicht, dass wir keine versöhnte Beziehung zu diesem Menschen haben.
Folgende zwei Texte leiten uns auf dem Weg der Versöhnung:
«Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer dar» (Matthäus 5,23f NLB).
«Wenn dir ein Bruder Unrecht getan hat, geh zu ihm und weise ihn auf seinen Fehler hin. Wenn er auf dich hört und seine Schuld zugibt, hast du ihn zurückgewonnen. Wenn es dir nicht gelingt, nimm einen oder zwei andere und geht noch einmal gemeinsam zu ihm, sodass alles, was du sagst, von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden kann. Wenn er auch dann nicht zuhören will, trage den Fall deiner Gemeinde vor. Wenn die Gemeinde dir Recht gibt, aber der andere auch dieses Urteil nicht anerkennt, dann behandelt ihn wie einen, der Gott nicht kennt, oder wie einen bestechlichen Steuereinnehmer» (Matthäus 18,15-17 NLB).
Der erste Text sagt, was man tun soll, wenn man selbst jemandem anderen geschadet hat; beim zweiten geht es darum, was man tut, wenn man glaubt, dass ein anderer einem Unrecht angetan hat. Man kann diese Abschnitte aber auch so betrachten, dass sie uns zwei Schritte des normalen Versöhnungsprozesses aufzeigen, denn selten trägt nur eine Partei allein die Schuld an einer zerrütteten Beziehung. Fast immer geschieht Versöhnung am besten, wenn beide Seiten Fehlverhalten einsehen und vergeben – wenn beide Seiten ihr eigenes Unrecht zugeben und das Unrecht des anderen aufzeigen.
Schritt 1: Alles benennen, was ich vielleicht falsch gemacht habe.
- Wenn ich den Eindruck habe, dass mein Verhalten nicht mehr als fünf Prozent des Problems ausmacht, sollte ich mit meinen fünf Prozent beginnen.
- Dann benenne ich die Dinge, die ich meiner Meinung nach, falsch gemacht habe. Anschliessend bitte ich die andere Person, die Liste zu ergänzen. Was habe ich ihrer Meinung nach zum Scheitern der Beziehung beigetragen?
- Anschliessend höre die Kritik an, um die ich gebeten habe, und versuche sie so klar und spezifisch wie möglich zu erfassen. Ich hüte mich davor, in Verteidigungsposition zu gehen. Der andere soll Raum vorfinden, seine Enttäuschung auszudrücken. Ich zeige Verständnis, auch wenn ich missverstanden wurde. Ich ermutige den anderen, dass wirklich alles auf den Tisch kommt.
Eine Falle ist, dass man sein Schuldgeständnis in einen Angriff verwandelt. «Wenn ich dich verletzt habe, tut es mir leid», ist so ein Klassiker. Es bedeutet: «Wenn du ein normaler Mensch wärst, hättest du dich über das, was ich getan habe, nicht so aufgeregt.» Eigentlich schiebt man die Schuld dem anderen in die Schuhe.
Echte Schuldeinsicht hat drei Aspekte: 1. Bekenntnis vor Gott. 2. Eingeständnis gegenüber der geschädigten Partei mit der Bitte um Vergebung. 3. Vorlegen eines konkreten Plans zur Veränderung, um das entsprechende Fehlverhalten in Zukunft zu vermeiden.
Wenn ich mein Verhalten tatsächlich bereue, sollte ich anschliessend die Aspekte benennen, dich nicht als Fehlverhalten meinerseits anerkennen kann. «Bitte, lass mich erklären, warum ich...»
Schritt 2: Ansprechen, inwiefern der oder die andere mich verletzt hat.
Oft bewegt dieses Vorgehen den oder die andere Person ebenfalls zu einem Schuldeingeständnis, ohne dass ich ihn darum bitten oder es herauskitzeln muss. Das ist der beste Weg, um Versöhnung zu erreichen. Wenn dies nicht geschieht, geht es darum, auf respektvolle und klare Weise das Unrecht des andern anzusprechen. «Du hast Folgendes getan...» «Und das hat für mich Folgendes bedeutet...» «Ich denke, es wäre für alle Beteiligten besser, wenn du in Zukunft Folgendes tun würdest...» Die Liste dessen, was die oder der andere getan hat, sollte konkret und nicht vage sein. Dabei soll das Problem benannt, die Person aber nicht verurteilt werden.
Wenn die betroffene Person eine Schuldeinsicht hat und um Vergebung bittet, dann gewähren wir sie liebend gerne. Was ist aber, wenn der oder die andere auch nach mehreren Anläufen keine Versöhnung will? In jedem Fall gilt: «Ist’s möglich, soviel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden» (Römer 12,8 LUT). In den darauffolgenden Versen finden wir eine Menge guter Ideen, wie wir gegenüber Menschen, die sich uns gegenüber abweisend verhalten, trotzdem grossmütig, freundlich, offen und herzlich sein können.
Wenn es aber einen anderen Nachfolger Jesu aus der gleichen Kirche betrifft, steht viel mehr auf dem Spiel. Unversöhnlichkeiten betreffen nicht nur die Einzelnen, sondern immer die grössere Gemeinschaft. In diesem Fall empfiehlt Jesus den zweiten Schritt zu gehen: einige christliche Freunde (vorzugsweise solche, die von der anderen Person respektiert werden) hinzuziehen, die uns darin unterstützen, eine Versöhnung zu erreichen. Wenn das trotz intensiver Bemühung nicht funktioniert, sollten die Verantwortlichen der Kirche gebeten werden, mit der betreffenden Person zu sprechen. Der Zweck eines solchen Gesprächs besteht nicht darin, den anderen zu demütigen, zu beschämen oder zu bestrafen, sondern an ihn zu appellieren und ihn zu überzeugen. Es wird also deutlich, dass es innerhalb einer Kirche keine Unversöhnlichkeiten geben darf. Das können wir uns nicht leisten, da es unsere Wirkung in diese Welt hinein stark mindert. Eine unserer grossen Aufgaben ist es, Beziehungen instand zu halten. Deshalb ist es uns so wichtig, dass während dieses Monats der Vergebung alle unversöhnte Beziehungen geklärt werden. Bitte komm auch auf jemanden der Gemeindeleitung zu, wenn du von dieser Kirche verletzt wurdest und dies noch in deinen Knochen steckt. Ein Kirchenwechsel ist in einer solchen Situation keine Option, da man unter diesen Umständen am neuen Ort von Anfang ein Bremsklotz ist.
Falls auch das Gespräch mit den Kirchenverantwortlichen nicht zur Versöhnung führt, «so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner» (Matthäus 18,17 LUT). Eine solche Person kann nicht in der Gemeinschaft der Kirche bleiben, wie wenn nichts geschehen wäre. Es bedeutet aber nicht, den Betreffenden zu meiden oder zu ächten, denn Jesus war dafür bekannt, dass er den Kontakt zu Zöllnern und Sündern suchte. Diese äusserste Massnahme der ‘Gemeindezucht’ dient dem Zweck, den Schuldigen zurückzugewinnen und seine geistliche Unversehrtheit wiederherzustellen.
Zum Schluss dieser Predigttrilogie über die Vergebung: Dreh- und Angelpunkt der Vergebung, die ich anderen gewähre, ist die Vergebung, die mir Jesus schenkt. Die Ressourcen dieser göttlichen Vergebung sind unfassbar gross: Einerseits führt es zu geistlicher Armut (Identifikation mit dem Sünder) und andererseits zu geistlichem Reichtum (Identität in Christus). Darauf lassen sich versöhnte Beziehungen aufbauen.
Mögliche Fragen für die Kleingruppen
Bibeltext lesen: Matthäus 5,23f; 18,15-17; Lukas 17,3
- Weshalb steht der inneren Vergebung nichts im Weg, auch wenn beim «Schuldner» keine Einsicht vorhanden ist oder er bereits gestorben ist?
- Gibt es in deinem Leben Beziehungen, bei denen eine Klärung (Konfrontation und Versöhnung) dran ist? Was hindert uns manchmal, diese Dinge anzupacken?
- Wie sieht die modellhafte Abwicklung eines Versöhnungsprozesses aus? Lebst du auf diese Weise Versöhnung in der Familie, im Freundeskreis oder der Kirche?
- Was ist der Dreh- und Angelpunkt der zwischenmenschlichen Versöhnungsarbeit? Was ist die Ressource darin? Hast du diese göttliche Vergebung für dich klar und eindeutig angenommen?