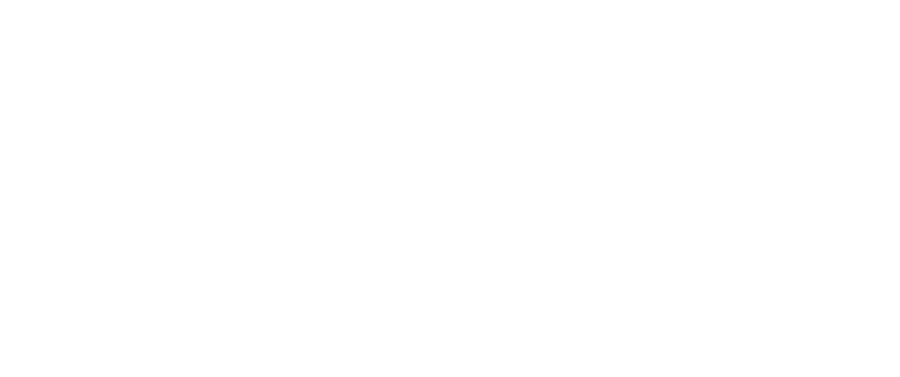Eglise & foi | Plus que dimanche
série : EIFACH muetig – avec Jésus comme modèle | Texte biblique : Jean 20:21–23 ; Actes 6:1–7
Bevor Jesus seine Freunde verliess, sprach er ihnen zu: «Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch» (Johannes 20,21). Um herauszufinden, was dies für die heutige Kirche bedeuten könnte, lohnt sich der Blick auf die erste Gemeinde in Jerusalem und die frühen Christen vor der konstantinischen Wende. Dabei stossen wir auf eine klare Botschaft, die Bereitschaft zum Martyrium und eine Fürsorge über alle sozialen und ethischen Grenzen hinweg. Diese Faktoren gehören auch heute noch zur Sendung und dem Auftrag der Kirchen.
Bildlich gesprochen soll eine Kirche wie ein Haus sein, in dem das Cheminée brennt und die Türen weit offenstehen. Im gleichen Sinn, aber mit anderen Worten erklärte Jesus seinen Freunden ihren Auftrag in der Welt: «Wieder sprach er zu ihnen und sagte: ‘Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch.’ Dann hauchte er sie an und sprach: ‘Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben’» (Johannes 20,21–23 NLB). Der Heilige Geist ist das Feuer, welches das Haus aufheizt. Daraus entspringt die Sendung und das ermächtigte Handeln nach aussen.
Faszination erste Kirche
Bei der Frage nach dem Auftrag und der Sendung der Kirche schauen wir zuerst aufs Original – auf die erste Kirche in Jerusalem. Sicher ist, dass Petrus auf seine Verkündigung der Guten Nachricht eine starke Resonanz erfuhr: «Doch viele der Menschen, die ihre Botschaft gehört hatten, glaubten daran, sodass die Zahl der Gläubigen auf etwa fünftausend Männer anstieg, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet» (Apostelgeschichte 4,4 NLB).
In der Jerusalemer Gemeinde wurde nicht nur gepredigt, sondern sie befassten sich auch mit handfesten diakonischen Herausforderungen: «Doch als die Zahl der Gläubigen immer grösser wurde, kam es auch zu Auseinandersetzungen. Diejenigen aus den griechischsprachigen Gebieten beschwerten sich bei den Hebräern, weil sie glaubten, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung benachteiligt würden» (Apostelgeschichte 6,1 NLB).
Am Pfingstfest hat Gott seinen Geist über viele Menschen ausgegossen. Er kommt zu Menschen – echten Menschen mit Herkunft, Geschichte und Identität. Menschen, die einem bestimmten Geschlecht angehören, aus unterschiedlichen Kulturen stammen und ganz unterschiedliche Lebenswege hinter sich haben. Alle verschieden. Und genau aus dieser Vielfalt formt Gott sich ein Volk: Sein Volk. Zu diesem Volk gehören auch ausländische Witwen. Bestandteil der jüdischen Kultur war, dass man Ausländer als minderwertig betrachtete und sie sogar als «Hunde» bezeichnete (Matthäus 15,27). Nicht weil man gemein sein wollte oder böse Absichten hatte, es war einfach normal. Ähnlich geringschätzend ging man mit Frauen um. Sie hatten nicht nur nichts zu sagen, sondern kaum Rechte und Möglichkeiten, sich selbst zu versorgen.
Diese ausländischen Witwen wurden auch in der Kirche benachteiligt, nicht aus Bosheit, sondern weil man es so gewohnt war und sich nichts dabei dachte. Dies widerspricht dem Wesen Gottes, der alle Menschen gleich wertschätzt. Der Geist Gottes braucht nun ausgerechnet die Stimme dieser Frauen, um die Gemeinschaft ein Stück heiler zu machen. Die Apostel erkennen das Wirken des Geistes in dieser Kritik und reagieren: Sie setzen Diakone ein, um die Versorgung gerecht zu gestalten. So wird die Gemeinde ein Stück mehr zu dem, was sie sein soll – ein Abbild Gottes. Gottes Geist greift tief hinein in die Alltäglichkeit dieser Welt – nicht nur in das Religiöse, sondern in das ganz leibliche, soziale Leben.
Faszination frühe Christen
Um noch weitere Impulse für unsere Sendung und unseren Auftrag zu erhalten, werfen wir unseren Blick auf die Zeit der frühen Christen bis zur konstantinischen Wende im 4. Jahrhundert. Diese Wende war dadurch gekennzeichnet, dass Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsreligion des Römischen Reiches erklärte. Von nun an, war jeder Bürger des Reichs durch die Geburt ein Christ. Wir leben heute im sogenannten nachkonstantinischen Zeitalter. Damit ist gemeint, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass jemand Christ ist. Unsere Zeit ähnelt in mancher Hinsicht der Kirche der frühen Christen. Auch damals waren die Christen eine kleine Minderheit im Römischen Reich in einer multireligiösen Gesellschaft mit vielen Optionen und völlig anderen ethischen Vorstellungen.
Obwohl die Christen damals den Staat nicht auf ihrer Seite hatten und verfolgt wurden, entwickelten sie in eine grosse Strahlkraft, die nicht zu übersehen war. Durch das positive Sich-Einbringen der Christen wurde das Römische Reich von innen heraus gewaltfrei erobert. Es kam zu kulturellen Veränderungen wie der Befreiung von Sklaven, der Aufwertung der Frauen, den Schutz des ungeborenen Lebens, etc.
Roland Werner hat zu diesem Thema geforscht und ein Buch mit dem Titel «Faszination frühe Christen» geschrieben. Drei Faktoren sollen aufgegriffen werden:
- Klare Botschaft: Es gibt ein frühes Graffito aus einer Katakombe in Rom, das zeigt, wie einer seinen Kollegen, der Christ war, verspottet. Abgebildet ist ein gekreuzigter Mensch mit Eselskopf und ein Mann, der mit erhobener Hand als Anbetungsgeste davorsteht. Als Spott steht darunter: «Alexamenos betet seinen Gott an». Die Botschaft ist: Wie verrückt muss man sein, einen Gekreuzigten anzubeten! Die Botschaft der Christen, dass es nur einen Gott gibt, und dass dieser eine Gott sich in einem gekreuzigten Jesus zeigt, der Jude war, war für die Römer auf allen Ebenen heller Wahnsinn. Dennoch, die frühen Christen waren in der Lage, die gute Nachricht zu formulieren: Gott ist erkennbar, Er liebt dich, Er gibt sich selbst für dich, die Frage deiner Schuld kann geklärt werden, Er hat am Kreuze die Mächte und Gewalten, vor denen die Leute Angst hatten, entwaffnet, Er ist auferstanden, d.h. wir haben jetzt echte Hoffnung für die Zukunft.
- Bereitschaf zum Martyrium: Von vielen christliche Märtyrern wird bezeugt, dass sie in Ruhe und Gelassenheit in den Tod gingen. Am 7. März 203 wurden zwei Frauen, Perpetua und Felicitas, in die Arena geführt, um dort für ihren Glauben zu sterben. Zehntausende von Menschen schrien: «Weg mit den Atheisten!». Die zwei Frauen schritten mutig ihrem irdischen Ende entgegen. Einige Menschen fragten sich: «Was ist das für eine Kraft? Die schaffen das, was uns unsere stoischen Philosophen beibringen wollen, nämlich mit Gelassenheit in den Tod zu gehen.»
- Fürsorge füreinander über alle sozialen und ethischen Grenzen hinweg: Es waren die Christen, die in den grossen Pandemien des 2. und 3. Jahrhunderts, die Waisenkinder und Kranken – auch die der Nicht-Christen – aufgenommen und gepflegt sowie die Toten beerdigt haben, die wegen Ansteckungsgefahr (Pest, Ebola) niemand anfassen wollte. Dort, wo soziale Strukturen zusammenbrachen, gab es in der christlichen Gemeinde ein Miteinander von Männer und Frauen, Sklaven und Freien, Reichen und Armen sowie Juden und Nicht-Juden.
Die Tatsache, dass es in der Gemeinde in Jerusalem eine Essensverteilung gab (Apostelgeschichte 6,1), war ganz selbstverständlich. Deshalb wird es nicht entfaltet, sondern nur nebenbei erwähnt. Das Christentum umfasste also das ganze Leben. Die römische Gemeinde hatte im 3. Jh. ungefähr 1500 Witwen auf ihrer Versorgungsliste. Johannes Chrystomos berichtete aus Antiochien (4. Jh.): «Unsere Gemeinde versorgt täglich 2500 Witwen und dennoch werden wir nicht ärmer.»
Die klare Botschaft, die Bereitschaft dafür das Leben zu geben und eine Fürsorge, die nicht nur bei ihren eigenen Leuten blieb, waren wesentliche Faktoren (zusammen mit Zeichen, Wunder und gewaltloser Feindesliebe) und liessen die Kirche trotz aller Verfolgung wachsen.
Faszination heutige Kirche
Diese drei Faktoren liefern für die aktuelle Kirche wichtige Impulse:
- Klare Botschaft: Sind wir in der Lage, die Gute Nachricht von Jesus Christus auf verständliche Weise in die heutige Kultur hineinzusprechen? Ein Berner Politiker des Grossen Rats leistete auf respektvolle Art, mit demütigem Herzen und klaren zeugnishaften Worten folgenden Beitrag zum Thema der psychischen Gesundheit der Jugend. (https://www.youtube.com/watch?v=i7X8_quegE8). Stefan Vatter erzählte an einem Kongress, dass sich das Evangelium in 30 Sekunden vermitteln lässt. Das seien die sieben zentralen Punkte: « Es gibt einen Gott. 2. Gott will mit dem Menschen in Beziehung treten. 3. Es gibt ein Problem – das Böse. 4. Gott hat dieses Problem in Jesus Christus gelöst. 5. Du kannst mit Gott in Beziehung treten. 6. Du hast einen Mentor. 7. Du wirst dich vor Gott verantworten müssen.» Und dann schreibt er, dass er im Allgäu drei Menschen zu Christus führen konnte, weil man beim Wandern über die Frage, ob die Erschaffung der Berge Zufall sei oder ob es Gott gebe, gesprochen habe. Manche Jesusnachfolger meinen, dass man den Auftrag ganz ohne Reden wahrnehmen kann. Dem widerspricht Petrus: «Macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben, aber freundlich und mit Achtung für die anderen […]» (1Petrus 3,15 NLB).
- Bereitschaft zum Martyrium: Auch wenn wir heutzutage nicht um das Leben fürchten müssen, wünschte ich mir, dass wir die Gelassenheit, die Zuversicht und die Hoffnung auf die Herrlichkeit bei Gott mit Paulus teilen könnten. Er sagt: «Car Christ est ma vie, et mourir est mon gain» (Philipper 1,21 LUT). Wer das Schönste vor sich weiss, kann souveräner mit dem Vorläufigen umgehen und muss nicht krampfhaft an diesem Leben festhalten.
- Fürsorge füreinander über alle sozialen und ethischen Grenzen hinweg: «Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, und ihr gabt mir zu trinken. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich in euer Haus eingeladen […]» (Matthäus 25,35 NLB). Jesus spricht darüber, dass Hilfe an Bedürftige gleichzeitig Hilfe an Ihm selbst ist – ein sehr starkes Zeugnis für den diakonischen Auftrag der Kirche. Obwohl es uns durch den Sozialverein Lichtblick gelingt, Menschen in ihren Nöten zu unterstützen, beschäftigen mich zwei Situationen: Kürzlich suchten wir über unser Wochenmail Unterstützung für eine alleinerziehende Mutter, die am Rand ihrer Kräfte ist und deren Ex-Mann seine Verantwortung nicht wahrnimmt. Ich bin überzeugt, dass wir als grosse Kirche solchen Menschen beistehen sollten. Oder: im Frühjahr 2022 erreichten uns viele ukrainischen Flüchtlinge. Dabei leisteten wir wertvolle Soforthilfe. Am Anfang kamen einige in den Gottesdienst. Leider ist das unterdessen abgeflacht. Ich empfinde, dass wir eine grosse Chance verpasst haben, indem wir keinerlei Anstrengung für die Integration diese Leute unternommen haben. Es wäre ein Abbild der frühen Kirche, wenn die unterschiedlichsten Menschen in unserer Gemeinschaft einen Platz finden könnten.
Stell dir ein Haus vor. Drinnen brennt ein Feuer – es ist warm, es leuchtet. Menschen spüren: Hier ist Leben. Hier ist Hoffnung. Die Türen stehen offen. Jeder darf kommen – egal, woher, egal wie verletzt. Nicht, weil das Haus besonders schön ist, sondern weil das Feuer echt ist. Dieses Feuer ist der Heilige Geist. Er macht das Haus lebendig – und schickt uns wieder raus. Denn das Ziel ist nicht, im Warmen zu bleiben. Wir tragen das Feuer weiter. Ein kleines Licht – aber stark genug, um Dunkelheit zu verändern. Du bist Teil dieses Hauses. Und du trägst den Funken in dir.
Questions possibles pour les petits groupes
Bibeltext: Apostelgeschichte 6,1–7; Johannes 20,21–23
- Was beeindruckt dich an der Art und Weise, wie die erste Kirche mit Herausforderungen und sozialen Spannungen umging? Wie könnten wir auf aktuelle Herausforderungen geistgeleitet reagieren?
- Was können wir heute konkret von der frühen Kirche lernen, die trotz Verfolgung wuchs?
- Fühlst du dich in der Lage, das Evangelium klar und verständlich zu erklären? Was hindert dich eventuell daran? Welche Erfahrungen hast du gemacht, wenn du über deinen Glauben gesprochen hast – positiv oder negativ?
- Was bedeutet für dich ‘Fürsorge über soziale und ethnische Grenzen hinweg’ – wo lebst du das konkret? Wie können wir als Kleingruppe oder Gemeinde besser darin werden, Menschen wirklich zu integrieren – nicht nur kurzfristig zu unterstützen?
- Was ist für dich persönlich der nächste Schritt, damit du selbst zu einem Hoffnungsträger wirst?